Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
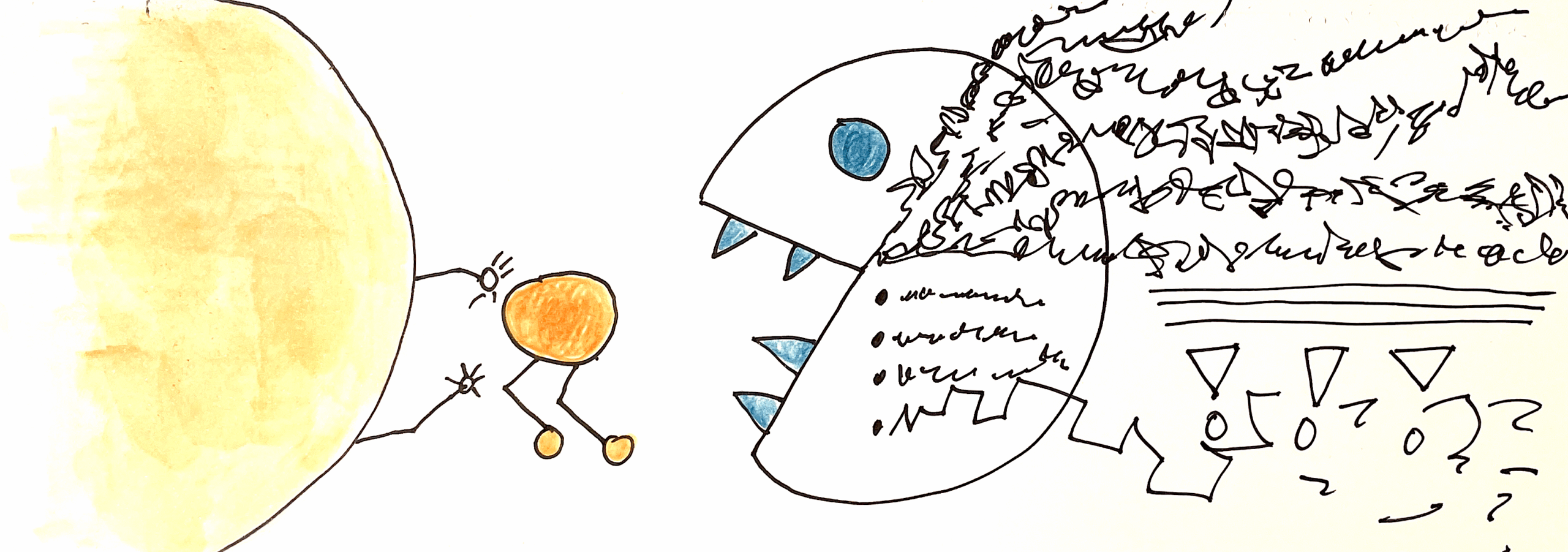
Viele Unternehmen wollen nicht nur profitabel sein, sondern auch moralisch gut. Die entsprechenden Bemühungen auf allen Kanälen hinauszuposaunen, gehört seit den 1960ern zur Leitlinie der westdeutschen Öffentlichkeitsarbeit, später der CSR und letztlich aller strategischer Kommunikation. Doch das ungute Gschmäckle dabei hielt sich hartnäckig und entfaltet sich nun vollends in der Greenwashing-Debatte. Hier versuche ich zu verstehen, was von Anfang an daran falsch war.
Vor ein, zwei Wochen joggte ich auf dem Gehsteig von Hamburg-Ottensen. Vor mir eine männliche Gestalt, die ich in wenigen Sekunden überholen würde. Stiernacken, kurzgeschoren, Ballonseiden-Anzug – Blitzeindruck also eher unsympathisch. Doch als uns noch 5 Meter trennten, bückte sich der Mann und fischte mit zwei Fingern einen schmutzigen, plattgefahrenen Milchkarton aus der Gehsteigrinne.
Ich dachte: „Wow!“ Und rannte an ihm vorbei.
Ich dachte, mittlerweile vor ihm: Du musst ihm zeigen, wie toll Du das findest, dass er sich so aufmerksam um seine Umgebung kümmert!
Also drehte ich mich zu ihm um, lächelte ihm zu und hob beide Daumen.
Der Mann stutzte erst, dann grimassierte er verschämt. Offensichtlich war ihm das peinlich, von mir bemerkt zu werden. Genauso gut hätte ich ihn beim Onanieren erwischen können.
Mein Versuch des Lobens und Ermutigens ging also voll nach hinten los.
Was war da passiert?!
Ein paar Tage später las ich Hannah Arendt, und was sie in ihrer Vita activa* schreibt, bestürzte mich noch mehr:
Das Verbrechen und das gute Werk haben miteinander eines gemein, nämlich, dass sie, wenn auch aus verschiedenen Gründen, sich vor den Augen und Ohren der Menschen verbergen müssen. Machiavellis Kriterium für politisches Handeln war das gleiche wie das des klassischen Altertums, nämlich der „strahlende Ruhm“, und Schlechtigkeit kann ebenso wenig erstrahlen wie Güte.*
„Güte“, das macht Arendt ein paar Seiten vorher klar, gehört eindeutig in die religiöse Sphäre und hat in der weltlichen nichts zu suchen. Tätige Güte müsse sich „in die Gesellschaft Gottes flüchten, des einzigen Zeugen der guten Werke, …“**
Sie ist eine intime Angelegenheit, die unbedingt verborgen bleiben muss und warnt:
Güte aber, die, ihrer Verborgenheit überdrüssig, sich anmaßt, eine öffentliche Rolle zu spielen, ist nicht nur nicht mehr eigentlich gut, sie ist ausgesprochen korrupt, und zwar durchaus im Sinne ihrer eigenen Maßstäbe; sie kann daher im Öffentlichen nur einen korrumpierenden Einfluss haben, wo immer sie sich zeigt.***
Wie bestechend diese Logik ist, zeigt sich an meiner Erfahrung mit dem Mann und seiner gütigen Handlung. Er war allein mit seinem Gott und seine Tat so rein wie Morgentau. Das war sein Moment, der nur ihm gehörte. Und dann kam ich, wurde Zeuge, zerrte alles ins grelle Licht und zerstörte genau diese religiöse Intimität, die Güte braucht.
Im Kern erklären Hannah Arendt – und mein Erlebnis – warum Image-PR und alles Getöne rund um Corporate Social Responsibility immer das sind, was sie ihrer Natur nach sein müssen: schein-heilig.
Öffentlich gemachte Güte
verführt zum Gähnen.
Unternehmen können, genau wie unser Milchkarton-Mann, keine Güte zeigen, ohne sie zugleich zu verderben. Je mehr sie sich bemühen, sich moralisch aufzuwerten, desto stärker verstricken sie sich in die Mechanismen der Selbstdarstellung – also genau in das, was Güte zerstört.
Das gilt selbst für aufrichtig gemeinte Nachhaltigkeitsberichte oder Purpose-Kampagnen: Sie sind öffentliche Bekenntnisse, nicht stille Handlungen. Sie mögen lediglich Fakten kommunizieren, doch der moralische Impuls ist immer schon verloren, sobald er PR wird.
Ich habe mich immer schon gewundert, und anschließend gescholten, warum ich bei diesen Themen immer vor Langeweile hintenüberkippe. Eigentlich sollte es mich ja begeistern oder zum Applaudieren anhalten. Aber dieses „rede darüber“ hat null Appeal. Öffentlich gemachte Güte verführt zum Gähnen. Arendt hätte das wohl „den Selbstwiderspruch der Tugend im Scheinwerferlicht“ genannt.
Wichtig dabei: Arendt unterscheidet strikt – in Anlehnung an die antike Polis – was dem Öffentlichen und was dem Privaten angehört. In beiden Sphären gelten unterschiedliche Werte und Spielregeln. Dass diese beiden Sphären heute fortwährend verwischt und vermischt werden, hielt sie schon zu ihren Lebzeiten für problematisch. Das war vor Social Media.
Unternehmen und ihre Kommunikation würde sie eindeutig dem Öffentlichen, dem Politischen zuordnen. Und in der Tat, die Polis der Wirtschaftswelt ist heute beinah stärker als die der politischen Welt. Das bedeutet: Sie sind öffentliche Wesen. Ihre Existenz ist auf Sichtbarkeit gegründet. Das bedeutet, sie können nicht „gut“ sein. Sie können, wie in jeder politischen Arena, nur „ruhmreich erstrahlen“ – das hat, ganz unmoralisch, viel mit Wettbewerb und Prahlerei zu tun.
Und das bedeutet: Es wäre viel moralischer, nüchtern diese Realität anzuerkennen. Lieber ruhmreich erstrahlen als purpose-haltig gut sein wollen. Das öffnet jedoch der Profit-und-sonst-gar-nichts-Fraktion eine Flanke, in der sie wieder ungehindert reinballern kann. Das kann’s jetzt auch nicht sein, oder?
Ein Ausweg öffnet sich in der Werte-Theorie von Tsunesaburō Makiguchi, dem Begründer der Soka-Philosophie. Soka heißt „Werte schaffen“ und er unterschied drei Arten von Werten: Nutzen, Güte und Schönheit.
Schon wieder „Güte“, aber sie ist anders konnotiert, was mangels Übersetzungsmöglichkeit nicht transportiert werden kann. „Zen“ lautet der japanische Begriff, übrigens nicht verwandt mit der gleichlautenden Silbe in „Zen“-Buddhismus. Dieses zen bedeutet eher „förderlich“ oder „Lebensqualität steigernd“ oder „allgemein wirksam“. Es passt hervorragend in das Öffentliche, weil damit das Nützliche gemeint ist, das ganz offen zwischen Menschen geschieht. Beispiel:
Ein Lehrer handelt „zen“, wenn er die Lernfreude seiner Schüler steigert.
Ein Unternehmen handelt „zen“, wenn es die Lebensbedingungen verbessert.
Makiguchi sah das Ziel menschlichen Handelns nicht in moralischer Makellosigkeit, sondern in der Steigerung von Lebenswert. „Gut“ ist bei ihm nicht das, was im Verborgenen vor Gott geschieht, sondern das, was zwischen Menschen Lebensqualität erzeugt. Es braucht nicht unbedingt ein Publikum – aber auch kein sakrales Schweigen. Es genügt, wenn die Handlung das Leben stärkt, anstatt es zu schmälern.
Damit verschiebt Makiguchi den Begriff von Güte radikal:
Bei Hannah Arendt bleibt Güte eine innere, religiöse Kategorie, die sich der Öffentlichkeit entzieht – sie gehört, wie sie schreibt, in „die Gesellschaft Gottes“.
Bei Makiguchi dagegen ist zen weltlich, relational, empirisch überprüfbar. Sie misst sich daran, ob sie Leben fördert, nicht daran, ob sie rein ist.
Arendt schützt die Güte vor der Öffentlichkeit, weil sie durch Sichtbarkeit verdirbt.
Makiguchis zen hingegen kommt ohne religiöse Intimität aus, vielmehr bekommt es im Miteinander Sinn.
Zwei völlig unterschiedliche „Güten“ also. Und jede hat ihren Platz.
Für die Praxis in Unternehmen öffnet Makiguchis zen wichtige Türen: Zen muss nicht moralisch wirken, sondern wirksam werden – und zwar in der realen Welt. Nicht „Gutes tun und darüber reden“, sondern: Wirken – prüfen – lernen – verbessern.
Kommunikation ist dann nicht der Versuch, Tugend zu zeigen, sondern ein Mittel, Verantwortung sichtbar zu machen.
Damit wäre die Wahl für Organisationen klar: In der Öffentlichkeit können sie nicht „gütig“ sein – nur ruhmreich oder pflichtbewusst.
Ruhmreich, wenn sie das Spiel der Eitelkeit beherrschen.
Pflichtbewusst, wenn sie einfach tun, was getan werden muss.
Arendt hätte wohl die zweite Variante bevorzugt – und Makiguchi auch, aber aus anderem Grund:
Arendt, um die Reinheit der Güte zu bewahren.
Makiguchi, weil das Pflichtbewusste, richtig ausgeführt, selbst Wert erzeugt und vielleicht gar zu einem stillen Ausdruck von Schönheit wird, der keiner Bühne bedarf.
Vielleicht liegt genau hier die Reifung, die wir in der Kommunikation noch vor uns haben. Nicht mehr die Pose des Guten, sondern die Praxis des Richtigen. Nicht mehr das ständige Bekenntnis zur Moral, sondern der Nachweis von Wirkung.
Unternehmen, die aus Pflicht handeln – aus einer klaren Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt –, wirken glaubwürdiger als solche, die sich moralisch inszenieren.
Das leise, sachliche Tun wird zum neuen Charisma.
Makiguchi hätte gesagt: Es erzeugt „Wert“.
Arendt würde ergänzen: Es bleibt frei von Eitelkeit.
Genau hier beginnt eine neue Form von Public Relations – eine, die nicht länger Gutes zeigt, sondern Gutes ermöglicht.
* Hannah Arendt, Vita activa oder vom tätigen Leben (siehe Kanon), S. 110
** ebd. S. 109
*** ebd. S. 110
The Barry Williams Show, Peter Gabriel
Howling, RY X
Anthem, Leonard Cohen
Die 3 Songs hören auf Spotify.
Alle Songs von Buddha-in-Business auf Spotify
Enjoy!
Schreib mir, wenn Du Feedback, weitere Gedanken oder Themenwünsche hast.
Abonnier den Newsletter, wenn Du über neue Beträge Bescheid wissen willst.
Beides ist eine Freude für mich. Vielen Dank.
#TruthBomb #MutMacher #SpirExercise