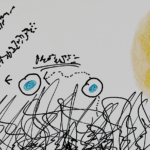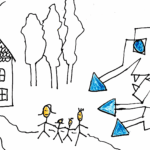Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Quellen & Grundlagen
Die Ausbreitung des Buddhismus lässt sich mit einem umgekehrten Flusssystem vergleichen: Eine starke ursprüngliche Quelle, von der viele Flüsse abzweigen, hauptsächlich in nördlicher und östlicher Richtung und erst viel später nach Westen, in unsere Weltgegend. Dennoch hinkt der Vergleich, so ist das ursprüngliche Quellgebiet – Indien – weitgehend ausgetrocknet. Und an anderen Orten in seinem Verlauf haben sich neue Quellen aufgetan. Da gab es „Nachfolge-Buddhas“, die den Buddhismus neu belebten und starke Gemeinschaften entstehen ließen.
Was die Gemeinschaft betrifft, der ich angehöre: Die Soka GakkaiZu deutsch etwa „Werteschaffende Gesellschaft“ – ist eine weltweite buddhistische Laienbewegung, die auf den Lehren des japanischen Mönchs Nichiren (1222–1282) basiert. Ihr Kern ist die Ausübung von Nam-Myoho-Renge-Kyo, dem Rezitieren des Titels des Lotos-Sutra, als unmittelbarer Weg, die in jedem Menschen vorhandene More – übersetzt „werteschaffende Gemeinschaft“ – dürfte heute weltweit die größte buddhistische Gemeinschaft sein. Etwa 12 Millionen Mitglieder in knapp 200 Ländern gehören ihr an. Kaum 100 Jahre alt, ist sie historisch gesehen noch ein Baby. Aber ihre Wurzeln lassen sich klar bestimmen und zurückverfolgen. Quellentreue – also das, worauf man sich beruft und warum – ist mir wichtig. Sie lehrt mir Bescheidenheit und Dankbarkeit jenen gegenüber, die uns den Weg geebnet haben.
Hier ein kurzer historischer Abriss zur Rückverfolgbarkeit und Einordnung der Lehren, auf die in diesem Blog Bezug genommen wird:
Siddharta Gautama, auch Shakyamuni genannt, ist der „Buddhabedeutet „Erwachter“ oder „Erleuchteter“. Ursprünglich bezeichnete das Wort in Indien jede Person, die religiöses Erwachen erlangte. Im Buddhismus meint es jemanden, der die ewige, höchste Wahrheit aller Dinge erkennt und andere zur gleichen Erkenntnis führt. Zunächst nur auf Shakyamuni bezogen, More“. Wir kennen ihn aus jedem Baumarkt, wo er gern als steingewordenes Symbol für Freundlichkeit und Gelassenheit verkauft wird. Dass er genau das geworden ist – Kult- und Anbetungsfigur – sehen viele als Widerspruch zu seinen Lehren, die sie empfehlen eines gerade nicht: Die Anbetung einer Kultfigur, einer äußeren Kraft. Vielmehr zielen auf die Konzentration und Verwirklichung unseres höchsten Potentials in uns und aus uns selbst heraus. Das ist die Kern-Absicht des Buddhabedeutet „Erwachter“ oder „Erleuchteter“. Ursprünglich bezeichnete das Wort in Indien jede Person, die religiöses Erwachen erlangte. Im Buddhismus meint es jemanden, der die ewige, höchste Wahrheit aller Dinge erkennt und andere zur gleichen Erkenntnis führt. Zunächst nur auf Shakyamuni bezogen, More, und zugleich der rote Faden, der sich durch die gesamte Buddhistory zieht.
Geboren wurde Shakyamuni etwa im 5. Jahrhundert v. u. Z. im heutigen Grenzgebiet zwischen Nepal und Indien. In einer Zeit, in der die spirituelle Landschaft Indiens stark vom Brahmanentum und einem rigiden Kastensystem geprägt war, stellte er die bestehende Weltordnung grundlegend in Frage. Statt ritueller Opfer und sozialer Hierarchien lehrte er einen inneren Weg zur Befreiung vom Leid – offen für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialem Rang. Allein durch die Entwicklung von Einsicht, ethischem Verhalten und geistiger Disziplin könne man zur Wahrheit gelangen.
Sein größtes Verdienst für die Menschheit war genau dieser radikale Perspektivwechsel: Die Idee, dass das Leiden nicht gottgegeben oder schicksalhaft ist, sondern aus Unwissenheit und Anhaftung entsteht – und dass es mithilfe eines klaren Übungsweges überwunden werden kann. Der sogenannte „Edle Achtfache Pfad“ wurde zum Kern seiner Lehre. Er verbindet Einsicht und Mitgefühl, Selbsterkenntnis und soziale Verantwortung. Nicht als Dogma, sondern als Anleitung zur Selbsterforschung.
Über vierzig Jahre lehrte Shakyamuni an vielen Orten Nordindiens, sammelte eine große Anhängerschaft und formte damit die erste buddhistische Gemeinschaft. Seine Reden (Sutras) wurden zunächst mündlich überliefert und später verschriftlicht. So entstand über die Jahrhunderte ein umfangreicher Kanon mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen.
Besonders hervorgehoben wurde später das Lotos-SutraDas Lotos-Sutra (Saddharma Pundarika Sutra), das „Sutra der Lotosblume des wunderbaren Gesetzes“) gilt im Nichiren- und Soka-Buddhismus als die höchste und abschließende Lehre Shakyamuni Buddhas. Es verkündet, dass ausnahmslos alle Menschen die Buddha-Natur besitzen und in diesem Leben Erleuchtung erlangen können More, das in seiner heutigen Form vermutlich einige Jahrhunderte nach Shakyamunis Tod entstand, aber zentrale Gedanken seiner späteren Lehrjahre enthält. Es stellt alle Wesen als grundsätzlich erleuchtungsfähig dar und betont, dass auch Laien – also nicht nur Mönche – das Erwachen erlangen können. Es ist die „große Gleichheit im Geiste“, die darin gefeiert wird, und die den Grundstein für spätere Bewegungen wie die des Nichiren-Buddhismus legte.
Diese inklusive und zutiefst humanistische Sichtweise wurde von vielen späteren Denkern aufgegriffen, weiterentwickelt und in neue gesellschaftliche Kontexte gestellt. Einer von ihnen ist Nagarjuna, der etwa 600 Jahre nach Shakyamuni lebte und mit seiner Philosophie des „Mittleren Weges“ den Mahayana-Buddhismus entscheidend prägte. Wie er das tat, erfährst du im nächsten Abschnitt.
Etwa im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung trat Nagarjuna in Erscheinung – zu einer Zeit, in der der Buddhismus sich bereits weit ausgebreitet hatte, aber Gefahr lief, in Dogmatik oder Spekulation zu erstarren. Nagarjuna, Philosoph und Mönch aus Südindien, griff tief in die geistige Schatztruhe des Buddhismus und stellte die Lehre auf ein neues Fundament: Er entwickelte die Philosophie der Leere (Sanskrit: śūnyatā) – nicht als Nihilismus, sondern als Befreiung von starren Vorstellungen, die unser Denken und Handeln einengen.
Sein zentrales Anliegen: die Mitte zu finden zwischen extremer Verneinung und naiver Behauptung. Weder ist die Welt in letzter Instanz fest und unabhängig, noch ist sie völlig illusionär. Alles entsteht in Wechselwirkung, durch Ursachen und Bedingungen. Wer dies erkennt, durchschaut auch das Ich als bloße Konstruktion und gewinnt Zugang zu einer tieferen, offenen Wirklichkeit.
Mit dieser Lehre des mittleren Weges hat Nagarjuna den Buddhismus neu belebt. Er gab dem Mahayana-Buddhismus – also dem „großen Fahrzeug“, das die Befreiung aller Wesen zum Ziel hat – seine philosophische Tiefe. Nagarjuna bestand darauf, dass Weisheit ohne Mitgefühl leer bleibt – und Mitgefühl ohne Weisheit blind. Die Vereinigung beider führt zum wahren Erwachen.
Seine Schriften, vor allem das Werk Mūlamadhyamakakārikā, wurden in viele Sprachen übersetzt und prägen bis heute den Buddhismus in Ostasien, Tibet und darüber hinaus. Aber ohne Vermittler hätten seine Gedanken kaum den Weg über die Sprachgrenzen hinweg gefunden.
Genau hier tritt die nächste Schlüsselfigur auf den Plan: Kumarajiva, Sohn einer indischen Gelehrtenfamilie und später einer der bedeutendsten Übersetzer in der Geschichte des Buddhismus. Ihm verdankt die chinesische Welt – und damit weite Teile Asiens – nicht nur präzise, sondern auch poetisch brillante Übertragungen zentraler Mahayana-Schriften, darunter auch Nagarjunas Werke. Wie er diese kulturelle Brücke schlug, erfährst du im nächsten Abschnitt.
Kumarajiva lebte im 4. und frühen 5. Jahrhundert und gilt bis heute als einer der größten Übersetzer in der Geschichte des Buddhismus. Geboren in einer gelehrten Familie aus dem heutigen Kaschmir, wurde er früh in die buddhistische Lehre eingeführt. Als Jugendlicher studierte er sowohl die Schriften des Theravada als auch die neuen Ideen des Mahayana. Diese doppelte Prägung sollte ihm später ermöglichen, als Vermittler zwischen Kulturen und Denkweisen zu wirken.
Seine Lebensreise führte ihn nach China, wo er vom Kaiserhof der späten Qin-Dynastie in die Hauptstadt Chang’an geholt wurde. Dort begann eine Übersetzungsarbeit von enormer Tragweite: Mit einem Team von über 800 Gelehrten übertrug Kumarajiva nicht nur Texte, sondern ganze Denkgebäude – präzise, aber zugleich mit einer sprachlichen Klarheit, die seine Werke bis heute lesbar macht.
Besonders wichtig war seine Übersetzung des Lotos-SutraDas Lotos-Sutra (Saddharma Pundarika Sutra), das „Sutra der Lotosblume des wunderbaren Gesetzes“) gilt im Nichiren- und Soka-Buddhismus als die höchste und abschließende Lehre Shakyamuni Buddhas. Es verkündet, dass ausnahmslos alle Menschen die Buddha-Natur besitzen und in diesem Leben Erleuchtung erlangen können More, das er nicht nur philologisch meisterhaft übertrug, sondern dessen Geist er auch verständlich und lebendig vermittelte. In China wurde es dadurch zu einem zentralen Text vieler buddhistischer Schulen. Auch Schriften Nagarjunas wurden dank Kumarajiva erstmals einem breiten Publikum zugänglich – und konnten ihre Wirkung in Ostasien entfalten.
Kumarajiva verstand, dass Sprache nicht nur überträgt, sondern auch formt. Er fand Begriffe und Bilder, die nicht nur den Inhalt, sondern auch den inneren Klang der Lehre weitertrugen. Damit war er nicht einfach ein Übersetzer, sondern ein echter „Transformator des Geistes“.
Seine Arbeit legte den Grundstein für eine eigenständige buddhistische Denktradition in China – nicht als bloße Reproduktion indischer Lehren, sondern als kreative Weiterentwicklung.
Einer der bedeutendsten Denker, der auf Kumarajivas Werk aufbaute, war Tiantai (Zhiyi). Er machte sich daran, die vielen buddhistischen Lehren systematisch zu ordnen und sie als eine kohärente Praxis des Erwachens zu begreifen. Welche bahnbrechende Klarheit und Tiefe seine Lehre gewann, erfährst du im nächsten Abschnitt.
Zhiyi, bekannt als Tiantai nach dem Berg, an dem er lehrte, lebte im 6. Jahrhundert in China. Er war der erste große buddhistische Denker, der versuchte, die Vielzahl der überlieferten Lehren zu ordnen – nicht durch Ausschluss, sondern durch Integration. In einer Zeit, in der sich verschiedenste buddhistische Schulen und Texte gegenseitig konkurrierend gegenüberstanden, wagte er einen umfassenden Blick: Was, wenn all diese Lehren verschiedene Perspektiven auf eine gemeinsame Wahrheit sind?
Sein Schlüssel war das Lotos-SutraDas Lotos-Sutra (Saddharma Pundarika Sutra), das „Sutra der Lotosblume des wunderbaren Gesetzes“) gilt im Nichiren- und Soka-Buddhismus als die höchste und abschließende Lehre Shakyamuni Buddhas. Es verkündet, dass ausnahmslos alle Menschen die Buddha-Natur besitzen und in diesem Leben Erleuchtung erlangen können More. Für Zhiyi war es nicht nur ein Text unter vielen, sondern die Krönung der Lehre Shakyamunis – nicht im historischen, sondern im spirituellen Sinn: Es offenbarte den einzigen Fahrzeugweg (ekayana), in dem alle Menschen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder geistigem Stand – zur Buddhaschaft fähig sind. Auf dieser Grundlage entwickelte er eine Lehrstruktur, die die unterschiedlichen Sutras nicht als Widerspruch, sondern als verschiedene Ebenen eines Weges verstand: von vorbereitenden Methoden bis zur höchsten Einsicht.
Sein berühmtestes Werk, das Große Werk über Konzentration und Einsicht (Mohe Zhiguan), verbindet tiefgründige Philosophie mit einer detaillierten Meditationspraxis. Es beschreibt, wie der Geist in seiner natürlichen Klarheit wiedergefunden werden kann – durch das Gleichgewicht von stiller Sammlung (zhi) und unterscheidender Einsicht (guan). Dabei betont Zhiyi, dass das Erwachen nicht irgendwo anders oder irgendwann später stattfindet, sondern im Hier und Jetzt dieses Lebens. Diese Sichtweise bildet eine wichtige Brücke zu späteren Mahayana-Formen des Alltagsbuddhismus.
Zhiyis Stärke war es, Gegensätze nicht aufzulösen, sondern in eine übergeordnete Einheit zu bringen – Denken und Fühlen, Praxis und Theorie, Konzentration und Reflexion. Damit beeinflusste er viele chinesische und japanische Schulen, darunter den Chan-Buddhismus (Zen) und auch die später von Nichiren gegründete Richtung.
Denn es war Nichiren, der im Japan des 13. Jahrhunderts das Lotos-SutraDas Lotos-Sutra (Saddharma Pundarika Sutra), das „Sutra der Lotosblume des wunderbaren Gesetzes“) gilt im Nichiren- und Soka-Buddhismus als die höchste und abschließende Lehre Shakyamuni Buddhas. Es verkündet, dass ausnahmslos alle Menschen die Buddha-Natur besitzen und in diesem Leben Erleuchtung erlangen können More wieder ins Zentrum rückte – nicht nur als meditativen Text, sondern als Ruf zur Selbstermächtigung in einer aus den Fugen geratenen Welt. Wie er das tat und warum seine Lehre bis heute wirkt, liest du im nächsten Abschnitt.
Nichiren wurde 1222 in Japan geboren – in eine Zeit gesellschaftlicher Umbrüche, politischer Instabilität und religiöser Orientierungslosigkeit. Der Buddhismus war zwar weit verbreitet, doch vielfach erstarrt in rituellen Formen oder spekulativen Lehren. Nichiren, ursprünglich Mönch in der Tendai-Schule, begann schon früh, den Sinn des Buddhismus konsequent vom Menschen her zu denken: Was nützt eine Lehre, wenn sie den Einzelnen nicht stärkt, Leid zu überwinden und sein Leben aktiv zu gestalten?
Nach intensiven Studien kam er zu einem radikalen Schluss: Nur das Lotos-SutraDas Lotos-Sutra (Saddharma Pundarika Sutra), das „Sutra der Lotosblume des wunderbaren Gesetzes“) gilt im Nichiren- und Soka-Buddhismus als die höchste und abschließende Lehre Shakyamuni Buddhas. Es verkündet, dass ausnahmslos alle Menschen die Buddha-Natur besitzen und in diesem Leben Erleuchtung erlangen können More entfalte das volle Potenzial der buddhistischen Lehre – nämlich, dass jeder Mensch Buddhanatur besitzt und sein Leben wandeln kann, so wie es gerade ist. 1253 verkündete er zum ersten Mal das Mantra „Nam-Myoho-Renge-Kyo“, das seither als Ausdruck dieses Erwachenswegs gilt. Es ist keine magische Formel, sondern eine bewusste Anrufung an das höchste Potenzial im eigenen Leben.
Nichiren war kein stiller Lehrer. Er griff Missstände offen an – auch religiöse Autoritäten – und wurde mehrfach verbannt, verfolgt und beinahe hingerichtet. Doch er blieb seinem Weg treu. Seine Schriften sind Zeugnisse eines tiefen Vertrauens in das Potenzial des Menschen und zugleich einer leidenschaftlichen Sorge um Gesellschaft und Frieden. Er sah spirituelle Entwicklung und gesellschaftliches Engagement nicht als Gegensätze, sondern als zwei Seiten derselben Medaille.
Er stellte den Menschen ins Zentrum – nicht als Objekt religiöser Gnade, sondern als handelndes Subjekt seiner eigenen Befreiung. Damit ebnete er den Weg für eine Form des Buddhismus, die nicht in Klöstern erstarrt, sondern im Alltag wirkt.
Diese Vision wurde viele Jahrhunderte später von einem japanischen Pädagogen wieder aufgegriffen: Tsunesaburo Makiguchi, geboren 1871, erkannte im Nichiren-Buddhismus einen Schlüssel zur Ermächtigung des Einzelnen – besonders im Bildungswesen. Wie er daraus eine Bewegung formte, die zur Keimzelle der Soka GakkaiZu deutsch etwa „Werteschaffende Gesellschaft“ – ist eine weltweite buddhistische Laienbewegung, die auf den Lehren des japanischen Mönchs Nichiren (1222–1282) basiert. Ihr Kern ist die Ausübung von Nam-Myoho-Renge-Kyo, dem Rezitieren des Titels des Lotos-Sutra, als unmittelbarer Weg, die in jedem Menschen vorhandene More wurde, liest du im nächsten Abschnitt.
Tsunesaburo Makiguchi, geboren 1871 in Japan, war kein Mönch und auch kein klassischer Religionsgründer. Er war Pädagoge – und ein unbequemer Geist, der sich nicht mit einem autoritären, auf Auswendiglernen basierenden Bildungssystem abfinden wollte. Für ihn war das Ziel von Erziehung nicht Gehorsam, sondern GlückWird hier im Sinne einer aktiven, dynamischen Lebenskunst verstanden. Wird im Soka-Buddhismus so beschrieben: • Glück ist hier eine innere Qualität und unabhängig von äußeren Umständen. Durch die Ausübung des Soka-Buddhismus kann ich Glück ansammeln oder trainieren. Wie einen Akku in More. Ein kühner Gedanke in einem Land, das zu dieser Zeit auf strikte Hierarchien, Nationalismus und Konformität setzte.
Makiguchi suchte nach einer Philosophie, die seine Vision von individueller Entfaltung und gesellschaftlicher Verantwortung stützen konnte – und fand sie in den Lehren Nichirens. Was ihn faszinierte, war der Gedanke, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, sein Leben zu verändern, unabhängig von äußeren Umständen. Der Buddhismus war für ihn kein Rückzug aus der Welt, sondern eine Anleitung zu selbstbestimmtem, werteschaffendem Handeln.
1930 gründete er gemeinsam mit seinem Schüler Josei Toda die Soka Kyoiku Gakkai, die „Gesellschaft für werteschaffende Erziehung“. Zunächst ein reformpädagogischer Kreis, entwickelte sich daraus bald eine spirituelle Bewegung, die den Buddhismus Nichirens zur Grundlage nahm – nicht als Dogma, sondern als Lebenspraxis.
Makiguchi lehrte, dass wahres GlückWird hier im Sinne einer aktiven, dynamischen Lebenskunst verstanden. Wird im Soka-Buddhismus so beschrieben: • Glück ist hier eine innere Qualität und unabhängig von äußeren Umständen. Durch die Ausübung des Soka-Buddhismus kann ich Glück ansammeln oder trainieren. Wie einen Akku in More entsteht, wenn der Mensch sich mit dem Wohl anderer verbindet. Diese Überzeugung führte ihn in offenen Widerstand zur damaligen Militärregierung, die Gehorsam forderte – auch in Glaubensfragen. Makiguchi weigerte sich, den staatlich verordneten Shintoismus zu unterstützen, wurde 1943 verhaftet und starb im Gefängnis.
Doch seine Ideen überlebten – getragen von Josei Toda, der nach Kriegsende die Bewegung neu aufbaute und daraus eine dynamische, engagierte Gemeinschaft formte: die Soka GakkaiZu deutsch etwa „Werteschaffende Gesellschaft“ – ist eine weltweite buddhistische Laienbewegung, die auf den Lehren des japanischen Mönchs Nichiren (1222–1282) basiert. Ihr Kern ist die Ausübung von Nam-Myoho-Renge-Kyo, dem Rezitieren des Titels des Lotos-Sutra, als unmittelbarer Weg, die in jedem Menschen vorhandene More.
Wie Toda aus dem Vermächtnis seines Lehrers eine moderne, kraftvolle Laienbewegung für Frieden, Kultur und Bildung machte, liest du im nächsten Abschnitt.
Josei Toda war Schüler, Mitstreiter und schließlich Nachfolger Tsunesaburo Makiguchis – und der Mann, der aus dessen Vermächtnis eine breite gesellschaftliche Bewegung formte. Geboren 1900, war Toda ursprünglich Mathematiklehrer, später Verleger und Unternehmer. Seine eigentliche Bestimmung aber fand er in der Zusammenarbeit mit Makiguchi, dessen reformpädagogische Ideen er nicht nur teilte, sondern in den Buddhismus Nichirens eingebettet weiterentwickelte.
Wie sein Lehrer wurde auch Toda während des Zweiten Weltkriegs inhaftiert, weil er sich weigerte, dem Staat in Glaubensfragen zu gehorchen. Im Gefängnis – unter schwersten Bedingungen – meditierte er über die tiefere Bedeutung des Lotos-Sutras und machte eine persönliche spirituelle Erfahrung, die er später als „Erwachen zur Buddhaschaft in diesem Leben“ beschrieb. Sie wurde zum Wendepunkt.
Nach dem Krieg, in einem Japan voller Trümmer, Angst und Orientierungslosigkeit, baute er die Soka GakkaiZu deutsch etwa „Werteschaffende Gesellschaft“ – ist eine weltweite buddhistische Laienbewegung, die auf den Lehren des japanischen Mönchs Nichiren (1222–1282) basiert. Ihr Kern ist die Ausübung von Nam-Myoho-Renge-Kyo, dem Rezitieren des Titels des Lotos-Sutra, als unmittelbarer Weg, die in jedem Menschen vorhandene More von Grund auf neu auf. Nicht als dogmatische Sekte, sondern als Bewegung für menschliches GlückWird hier im Sinne einer aktiven, dynamischen Lebenskunst verstanden. Wird im Soka-Buddhismus so beschrieben: • Glück ist hier eine innere Qualität und unabhängig von äußeren Umständen. Durch die Ausübung des Soka-Buddhismus kann ich Glück ansammeln oder trainieren. Wie einen Akku in More. Er rief seine Mitmenschen dazu auf, wieder an sich selbst zu glauben, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und durch die buddhistische Praxis Kraft zu gewinnen, Schwierigkeiten aktiv zu überwinden.
Toda verstand Buddhismus nicht als Rückzug ins Private, sondern als Gestaltungskraft für die Gesellschaft. Er trat öffentlich gegen Atomwaffen ein, setzte sich für Bildungsreformen ein und prägte die drei Grundpfeiler der Soka GakkaiZu deutsch etwa „Werteschaffende Gesellschaft“ – ist eine weltweite buddhistische Laienbewegung, die auf den Lehren des japanischen Mönchs Nichiren (1222–1282) basiert. Ihr Kern ist die Ausübung von Nam-Myoho-Renge-Kyo, dem Rezitieren des Titels des Lotos-Sutra, als unmittelbarer Weg, die in jedem Menschen vorhandene More: Frieden, Kultur, Bildung. Innerhalb weniger Jahre wuchs die Gemeinschaft auf Millionen von Mitgliedern an – getragen vom tiefen Wunsch vieler Menschen, ihr Leben aus eigener Kraft zu verwandeln.
Am Ende seines Lebens übergab er den Staffelstab an einen jungen, leidenschaftlichen Schüler, der sein Erbe nicht nur bewahren, sondern weltweit verbreiten sollte: Daisaku Ikeda, ein Dichter, Denker und Menschenfreund, der die Soka-Gakkai-Bewegung in eine neue Ära führte. Wie er das tat – und was ihn zu einer der einflussreichsten spirituellen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts machte –, erfährst du im nächsten Abschnitt.
Daisaku Ikeda wurde 1928 in Tokio geboren, als fünftes von acht Kindern einer armen Familie. Der Krieg prägte seine Jugend: Hunger, Krankheit, Zerstörung – und der frühe Verlust seines Bruders, gefallen an der Front. Diese Erfahrungen machten ihn sensibel für das Leiden der Menschen und weckten in ihm eine tiefe Sehnsucht nach einer Lebensweise, die dem Leben selbst dient – nicht Macht, Ideologie oder Profit.
Mit 19 Jahren begegnete er dem Buddhismus Nichirens und wurde Schüler von Josei Toda. Nach dessen Tod 1958 übernahm Ikeda die Präsidentschaft der Soka GakkaiZu deutsch etwa „Werteschaffende Gesellschaft“ – ist eine weltweite buddhistische Laienbewegung, die auf den Lehren des japanischen Mönchs Nichiren (1222–1282) basiert. Ihr Kern ist die Ausübung von Nam-Myoho-Renge-Kyo, dem Rezitieren des Titels des Lotos-Sutra, als unmittelbarer Weg, die in jedem Menschen vorhandene More – zunächst in Japan, dann weltweit. Er war kein Intellektueller im Elfenbeinturm, sondern ein Visionär mit klarem Blick für das Konkrete: Bildung als Herzstück der Humanität, Dialog als Brücke zwischen Kulturen, die innere Revolution als Voraussetzung für gesellschaftlichen Wandel.
Unter seiner Leitung wurde die Soka GakkaiZu deutsch etwa „Werteschaffende Gesellschaft“ – ist eine weltweite buddhistische Laienbewegung, die auf den Lehren des japanischen Mönchs Nichiren (1222–1282) basiert. Ihr Kern ist die Ausübung von Nam-Myoho-Renge-Kyo, dem Rezitieren des Titels des Lotos-Sutra, als unmittelbarer Weg, die in jedem Menschen vorhandene More zu einer weltweiten Bewegung, die heute in 192 Ländern aktiv ist. Ikeda gründete Schulen und Universitäten, initiierte Friedensdialoge mit Staatschefs und geistigen Autoritäten, veröffentlichte jährlich Friedensvorschläge an die UNO, schrieb Gedichte, philosophische Essays und tauschte sich mit Persönlichkeiten wie Arnold Toynbee, Rosa Parks oder Nelson Mandela aus.
Sein zentrales Anliegen: Die Würde des Lebens in jeder einzelnen Person sichtbar zu machen. Buddhismus war für ihn kein Rückzug, sondern ein Aufbruch – ein Werkzeug, um den Alltag zu verwandeln, Konflikte zu überwinden und eine Kultur des Friedens zu fördern. Sein Leben ist der Beweis, dass eine einzelne Stimme Millionen inspirieren kann.
Und nun – viele Jahrzehnte später – bin ich einer von denen, die durch Ikedas Arbeit inspiriert wurden. Ein Mensch unserer Zeit, aufgewachsen in einer ganz anderen Welt, aber mit demselben Wunsch: das eigene Leben zu verstehen, Sinn zu stiften und einen Beitrag zu leisten.
Dieser Blog ist mein Weg, dieses Erbe weiterzuführen – als persönliche Entdeckungsreise, ausgehend von einer lebendigen Linie, die bei Shakyamuni begann und in jeder und jedem von uns weiterlebt. Sofern man sie verfolgen möchte.
Sechzehn Werke bilden den Kanon für diesen Blog. Sie werde ich oft heranziehen und zitieren.
Fünf Werke entstammen dem Buddhismus, die anderen elf kommen aus der Religionspsychologie, Anthropologie, Sozialphilosophie & Pädagogik.
Hier stelle ich sie kurz vor:
[erschienen 2007 bei Primus Verlag, ISBN 3896786074]
Das steckt drin: Das Herzstück der Lehren des historischen Buddhabedeutet „Erwachter“ oder „Erleuchteter“. Ursprünglich bezeichnete das Wort in Indien jede Person, die religiöses Erwachen erlangte. Im Buddhismus meint es jemanden, der die ewige, höchste Wahrheit aller Dinge erkennt und andere zur gleichen Erkenntnis führt. Zunächst nur auf Shakyamuni bezogen, More Gautama Siddharta. In 28 Kapiteln – teils in Vers- teils in Prosaform – wird ein kosmischer Transformationsprozess beschrieben. Dies geschieht im Rahmen einer – ebenfalls kosmischen – Versammlung. Alle Lebewesen kommen zusammen und lauschen dem Buddhabedeutet „Erwachter“ oder „Erleuchteter“. Ursprünglich bezeichnete das Wort in Indien jede Person, die religiöses Erwachen erlangte. Im Buddhismus meint es jemanden, der die ewige, höchste Wahrheit aller Dinge erkennt und andere zur gleichen Erkenntnis führt. Zunächst nur auf Shakyamuni bezogen, More. Hier lehrt er, dass alle seine bisherigen Lehren nur vorläufig und kontext-abhängig gewesen seien, und dass es noch ein gewaltigeres, umfassenderes Seinsverständnis (Dharma) gibt.
Ohne diesen Text und dessen Wirkkraft wäre der Buddhismus nichts weiter als eine entspannende Meditationsform mit folkloristischem Zauber – also das, was das normale westliche Wesen sowieso von ihm hält. Das Lotos-SutraDas Lotos-Sutra (Saddharma Pundarika Sutra), das „Sutra der Lotosblume des wunderbaren Gesetzes“) gilt im Nichiren- und Soka-Buddhismus als die höchste und abschließende Lehre Shakyamuni Buddhas. Es verkündet, dass ausnahmslos alle Menschen die Buddha-Natur besitzen und in diesem Leben Erleuchtung erlangen können More ist aber die Grundlage für einen kraftvollen gesellschafts-verändernden Buddhismus. Es ist die einzige Lehre, die: 1) allen Wesen im Kosmos die Buddhanatur zuspricht und die Möglichkeit, diese voll zu entfalten, 2) Schluss macht mit jeglicher Diskriminierung, 3) Schluss macht mit jeglicher spirituellen Hierarchie, auch der zwischen Priestern und Laien, 4) und auch radikal feministisch ist. Letzteres ein absoluter Einzelfall in den männlich dominierten und definierten Weltreligionen. Bis heute.
Zudem beschreibt es die Dynamik des Lebens, so wie es ist, und wie wir in ihr wachsen und gedeihen können. Es ist eine Schrift der radikalen Nicht-Diskriminierung, von der Gleichheit aller Menschen und somit die beste spirituelle Grundlage für eine sich erneuernde Demokratie. Ich durfte mich ein paar Jahre intensiv mit diesem Werk befassen, weil ich eine seiner Übertragungen ins Deutsche redaktionell betreut habe.
Beitrag zum Blog: Ich werde auf das Lotos-SutraDas Lotos-Sutra (Saddharma Pundarika Sutra), das „Sutra der Lotosblume des wunderbaren Gesetzes“) gilt im Nichiren- und Soka-Buddhismus als die höchste und abschließende Lehre Shakyamuni Buddhas. Es verkündet, dass ausnahmslos alle Menschen die Buddha-Natur besitzen und in diesem Leben Erleuchtung erlangen können More zurückgreifen, wenn ich zeigen will, wie früh Demokratie, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, Menschenwürde oder „positive Change“ im Bewusstsein der Menschen verankert waren. Zudem liefert es Bilder, Geschichten und Gleichnisse, die den Wert des Lebens in atemberaubender Schönheit verdeutlichen.
[6 Bände, erschienen 2003 bei SGI Deutschland, ISBN 4884170905,
als e-Book erhältlich oder als Softcover direkt im Shop der Soka GakkaiZu deutsch etwa „Werteschaffende Gesellschaft“ – ist eine weltweite buddhistische Laienbewegung, die auf den Lehren des japanischen Mönchs Nichiren (1222–1282) basiert. Ihr Kern ist die Ausübung von Nam-Myoho-Renge-Kyo, dem Rezitieren des Titels des Lotos-Sutra, als unmittelbarer Weg, die in jedem Menschen vorhandene More Deutschland]
Das steckt drin: In den sechs Bänden geht Daisaku Ikeda mit seinen Gesprächspartnern das Lotos-SutraDas Lotos-Sutra (Saddharma Pundarika Sutra), das „Sutra der Lotosblume des wunderbaren Gesetzes“) gilt im Nichiren- und Soka-Buddhismus als die höchste und abschließende Lehre Shakyamuni Buddhas. Es verkündet, dass ausnahmslos alle Menschen die Buddha-Natur besitzen und in diesem Leben Erleuchtung erlangen können More Kapitel für Kapitel durch und durchforscht dabei seine Bedeutung und Relevanz für die heutige Zeit. Wie viele von Ikedas Werken ist auch dieses ein Brückenwerk – diesmal ein zeitliches: von der Entstehungszeit des Lotos-SutraDas Lotos-Sutra (Saddharma Pundarika Sutra), das „Sutra der Lotosblume des wunderbaren Gesetzes“) gilt im Nichiren- und Soka-Buddhismus als die höchste und abschließende Lehre Shakyamuni Buddhas. Es verkündet, dass ausnahmslos alle Menschen die Buddha-Natur besitzen und in diesem Leben Erleuchtung erlangen können More vor circa 2000 Jahren bis zur heutigen Moderne, wo die traditionellen Religionen nicht mehr richtig greifen und der moderne Mensch sich zunehmend lost fühlt.
Beitrag zum Blog: Ich hatte für die deutsche Veröffentlichung dieses Werks das Lektorat übernommen. Das war meine „buddhistische Grundausbildung“ und die aufregendste geistige Reise meines Lebens. Im Blog werde ich mich seiner immer dann bedienen, wenn das Thema „menschliche Transformation“ begreifbar und relevant für unsere heutige Lebenssituation dargelegt werden soll.
[erschienen 2014 bei Herder Verlag, ISBN 3451334542]
Das steckt drin: Der Nichiren-Buddhismus hat das GlückWird hier im Sinne einer aktiven, dynamischen Lebenskunst verstanden. Wird im Soka-Buddhismus so beschrieben: • Glück ist hier eine innere Qualität und unabhängig von äußeren Umständen. Durch die Ausübung des Soka-Buddhismus kann ich Glück ansammeln oder trainieren. Wie einen Akku in More, dass die meisten Schriften seines Gründers erhalten geblieben sind und deshalb wenig interpretatorische Willkür zulässt. Mit Fußnoten und Erläuterungen umfasst es etwa 10.000 Taschenbuchseiten. Darunter befinden sich ein knappes Dutzend größere Abhandlungen, Erfahrungsberichte von seinem Leben und seiner Entwicklung und vor allem unzählige Briefe an seine Schüler und Anhänger. Das Werk zeichnet sich durch 4 religionshistorische Besonderheiten aus:
Beitrag zum Blog: Nichirens Schriften sind die Grundlage des Buddhismus der Soka GakkaiZu deutsch etwa „Werteschaffende Gesellschaft“ – ist eine weltweite buddhistische Laienbewegung, die auf den Lehren des japanischen Mönchs Nichiren (1222–1282) basiert. Ihr Kern ist die Ausübung von Nam-Myoho-Renge-Kyo, dem Rezitieren des Titels des Lotos-Sutra, als unmittelbarer Weg, die in jedem Menschen vorhandene More, jener Laienbewegung, der ich angehöre. Wir studieren sie regelmäßig, wobei „studieren“ bedeutet: im eigenen Leben erfahren und umsetzen. Sie sind also bis heute lebendige Inspiration. Im Blog zitiere ich das, was auch Nicht-Soka-Buddhisten wertvolle Einsichten bietet, vor allem zu den Themen: menschliche Transformation, Lebensglück, spirituelle Stärke, menschengerechte und missbrauchsfreie Religion sowie zu den tieferen Grundlagen für Solidarität, Kollaboration und Teamwork.
Ich hatte das GlückWird hier im Sinne einer aktiven, dynamischen Lebenskunst verstanden. Wird im Soka-Buddhismus so beschrieben: • Glück ist hier eine innere Qualität und unabhängig von äußeren Umständen. Durch die Ausübung des Soka-Buddhismus kann ich Glück ansammeln oder trainieren. Wie einen Akku in More, dieses Werk für die deutsche Veröffentlichung zu übersetzen, teils im Team, teils allein. Alle 10.000 Taschenbuchseiten sind also schon mal durch mein Hirn gerauscht. Bis sich Nichirens Weisheit und Mitgefühl in meinem Herzen verankern, wird es noch etwas dauern.
Zhiyi, bekannt als Tiantai nach dem Berg, an dem er lehrte, lebte im 6. Jahrhundert in China. Er war der erste große buddhistische Denker, der versuchte, die Vielzahl der überlieferten Lehren zu ordnen – nicht durch Ausschluss, sondern durch Integration. In einer Zeit, in der sich verschiedenste buddhistische Schulen und Texte gegenseitig konkurrierend gegenüberstanden, wagte er einen umfassenden Blick: Was, wenn all diese Lehren verschiedene Perspektiven auf eine gemeinsame Wahrheit sind?
Das steckt drin: 16 Auszüge aus den wichtigsten Reden, die Daisaku Ikeda an den Universitäten dieser Welt gehalten hat. Sie setzen den Mahayana-Buddhismus in Bezug zu den Philosophien dieser Welt, in der Absicht ihn innerhalb eines globalen Humanismus zu verorten und zu verknüpfen. Im Buch sind sie zu vier Themen sortiert, die seinen Reden nachträglich eine Struktur und einen übergeordneten Sinn verleihen: 1) Bildung – Impulse für die Zukunft, 2) Kultur – Dimensionen und Wirkungen, 3) Religion – Ihr Beitrag zur Moderne, 4) Frieden – Die unbedingte Aufgabe.
Beitrag zum Blog: Diese Reden entstanden während der Blütezeit von Daisaku Ikedas globalem Wirken – den 90ern. In dieser Zeit stand das Fenster für einen globalen Humanismus offen, bis es sich 2001 wieder schloss. Wenn wir diesen Möglichkeitsraum wieder öffnen und erweitern möchten, dann können Ikedas Einsichten, Verknüpfungen und Anregungen weiterhelfen. Vor allem in dem einen Punkt, den wir in den 90ern im Westen übersehen haben: in der Erneuerung und Stärkung unseres inneren Lebens, unserer Spiritualität. Im Soka-BuddhismusEine moderne Ausprägung des Nichiren-Buddhismus, benannt nach dem japanischen Mönch Nichiren (1222–1282). Wie andere buddhistische Traditionen teilt er Grundprinzipien wie die Vergänglichkeit aller Dinge, die wechselseitige Verbundenheit allen Lebens und das Ziel, Leid zu überwinden. Seine Besonderheit liegt jedoch in der More nennen wir diesen Prozess „Menschliche RevolutionEin zentrales Konzept im Soka-Buddhismus. Es beschreibt den tiefgreifenden inneren Wandel eines Menschen – eine Veränderung der grundlegenden Haltung, Werte und Sichtweisen –, die zu positiver Veränderung im eigenen Leben und im Umfeld führt. Man spricht von einer „Revolution“, weil More“, weil er sich im eigenen Leben tatsächlich wie eine Revolution anfühlt. Diese Art von erneuerter Spiritualität ist weit umfassender als das, was uns die New-Age-Bewegung an Trends beschert hat. Sie ist erstaunlich pragmatisch. Nicht umsonst knüpft Daisaku Ikeda in seinen Reden an die amerikanischen Pragmatisten wie John Dewey an.
Dieses Buch ist eine einzigartige Konstruktion von Brücken, die in die Kulturen dieser Welt hineinreichen. Es beschreibt eine mögliche Globalisierung des Buddhismus – nicht in beherrschender oder gar kolonialer Absicht, sondern in einem Dialogprozess, der alle Beteiligten – und ihr jeweiliges Glaubens- und Gedankengut – fortlaufend bereichert und transformiert.
[erschienen 2002 bei Soka GakkaiZu deutsch etwa „Werteschaffende Gesellschaft“ – ist eine weltweite buddhistische Laienbewegung, die auf den Lehren des japanischen Mönchs Nichiren (1222–1282) basiert. Ihr Kern ist die Ausübung von Nam-Myoho-Renge-Kyo, dem Rezitieren des Titels des Lotos-Sutra, als unmittelbarer Weg, die in jedem Menschen vorhandene More, ISBN 4412012050]
Das steckt drin: Meines Wissens das umfangreichste und genaueste Wörterbuch zum Buddhismus, weit über den Nichiren-/Soka-Buddhismus hinausreichend und weder tendenziös noch wertend. Es erklärt alle historischen und mythischen Figuren, Konzepte, Begriffe und historische Begebenheiten – und ordnet die Zusammenhänge und Parallelitäten zwischen den sanskritischen, pali-, chinesischen, koreanischen und japanischen Begriffen.
Beitrag zum Blog: Ich nutze dieses Wörterbuch immer zum Abgleich, wenn ich buddhistische Konzepte und Begriffe erkläre. Dabei prüfe ich, ob (m)eine moderne Interpretation oder Exemplifizierung davon guten Gewissens vertretbar ist.
[erschienen 2021 bei dtv, ISBN 3423350587]
Das steckt drin: Frankl kritisiert in diesem Buch den Ansatz der Freudschen Psychoanalyse als unvollständig, wenn nicht gar fehlgeleitet. Nicht nur eine triebhafte Libido bestimme das Unbewusste, sondern mindestens ebenso sehr eine „unbewusste, verdrängte religio“. Damit meint er unser Verlangen nach Transzendenz, nach einer Verbindung zu dem „großen Ganzen“. Dieses Verlangen ist nicht so treibend wie das nach Sex, sondern stiller, eher wie ein leerer Raum, der darauf wartet, gefüllt zu werden.
Dieses Werk ist für mich das heftigst-ignorierte in der modernen Psychologie, die beharrlich versucht, alles Transzendente im Therapieprozess auszuklammern und es bestenfalls als nicht unbedingt notwendige Ressource des Patienten begreift … aber eben nicht als bestimmendes Element, wie es Frankl und seine von ihm entwickelte Logotherapie (Sinn-Therapie) tun.
Beitrag zum Blog: Frankls Werk dient mir als Brücke zwischen Religion und Psychotherapie. Auch wenn er in der abendländisch jüdisch-christlichen Tradition steht, von „Gott“ als transzendenten Bezugspunkt spricht und theologisch argumentiert, trägt sein Plädoyer auch als Brücke zum Buddhismus. Ich gehe sogar noch weiter: Gerade weil sich viele Menschen von den Kirchen und Gott als Sinnstifter abwenden, könnte ihnen der Buddhismus ein neues spirituelles Zuhause bieten und dieses tiefe innere Bedürfnis nach transzendenter Verbindung wieder stillen. Dies führe ich in einzelnen Blog-Beiträgen noch weiter aus. Ich zitiere Frankl als Nicht-Buddhisten, um zu verdeutlichen, dass der Mensch nicht „nicht glauben“ und nicht „Nicht-Sinn-produzieren“ kann.
[erschienen 2014 bei Verlag der Weltreligionen im Insel Verlag Berlin, ISBN 3458720218]
Das steckt drin: William James ist nicht nur Gründungsfigur der Religionspsychologie, sondern der Psychologie überhaupt. Das Buch entstand 1902, bislang gibt es keinen aktuelleren empirischen Forschungsbericht über religiös-spirituelle Erfahrungen. Es enthält 20 Vorlesungen. Darin lässt er alle dogmatisch-theologischen Konzepte beiseite und beschränkt sich auf das, was Menschen in ihrem Glauben tatsächlich erfahren. Er war einer der ersten modernen Denker, die Religion nicht als Illusion oder Irrtum betrachteten, sondern als legitimen Teil der seelischen Wirklichkeit. Damit grenzt er sich von reduktionistischen Wissenschaftlern ab, die die moderne Psychologie bis heute prägen.
Sein Forschungsgegenstand ist der gleiche wie bei Freud: das Unbewusste, doch James beschreibt es offener, umfassender und nicht pathologisierend. Viktor Frankl, im Kanon ebenfalls vertreten (siehe oben) greift diesen verlorenen Faden wieder auf und bezieht sich ausdrücklich auf James‘ Grundlagenwerk. Beide forschen im vernachlässigten Raum der klinischen Psychologie, pragmatisch statt deutend, phänomenologisch statt analysierend, erfahrungsnah-beziehend statt interpretierend.
In seinen Vorlesungen beschreibt James die Religion nicht als Dogma, sondern als subjektives Erleben. Dabei wird klar: Bekehrungen, mystische Zustände und religiöse Krisen sind psychologisch reale, lebensverändernde Erfahrungen.
Beitrag zum Blog: Mich stärkt dieses Buch in einer neugierigen, undogmatischen Sicht auf Spiritualität, jenseits von Dogmatik und Esoterik. Es hilft zu verstehen, warum Menschen glauben oder eine spirituelle Praxis ausüben – und was dies im Leben leisten kann. Es bietet einen offenen, ehrlichen Blick auf das, was Frankl das geistige Unbewusste nennt.
James war Empiriker und konnte deshalb nur die religiösen Erfahrungen von christlich-jüdisch geprägten Menschen in Amerika beschreiben. Auch wenn in seinem Werk keine explizit „buddhistische“ Erfahrung vertreten ist, kommt er dem Buddhismus sehr nahe: durch seinen phänomenologischen Zugang, seinen Pragmatismus und seine Achtung vor der Vielfalt mystischer Erfahrung und seelischer Zustände.
Genau wie Frankls Buch ist James‘ „Vielfalt“ ein Vertreter der christlich-jüdischen Kultur. Beide tragen dazu bei, unseren buddhistischen Blog vollständiger, runder und universaler zu machen.
[erschienen 1989 bei suhrkamp taschenbuch Wissenschaft, ISBN 3518300169]
Das steckt drin: Dewey fragt, wie in einer komplexen, arbeitsteiligen Welt überhaupt noch gemeinsames politisches Handeln möglich ist. Seine Antwort: Nur durch eine Öffentlichkeit, die nicht von Meinungsmache und Technokratie beherrscht wird, sondern durch Austausch, Beteiligung und Lernen lebt. Demokratie ist für ihn kein Verfahren, sondern eine Lebensform: offen, provisorisch, gemeinschaftsbildend. Eine tiefgründige, aber nüchtern-pragmatische Verteidigung des Miteinanders in Zeiten wachsender Entfremdung.
Beitrag zum Blog: Dieses Buch hilft mir, den Begriff von „Führung“ zu entgrenzen – weg von Hierarchie, hin zu Verantwortung im kollektiven Raum. Es zeigt: Wir sind nicht nur Subjekte unserer Innenwelt, sondern Mitgestalter einer gemeinsamen Welt. Für die Lesenden eröffnet Dewey eine Perspektive jenseits von Zynismus und Vereinzelung – als Einladung, sich einzumischen, im Kleinen wie im Großen. Öffentlichkeit ist nicht Bühne, sondern Beziehung.
[erschienen 2004 bei suhrkamp verlag wissenschaft, ISBN 3518292471]
Das steckt drin: Viel. Hier interessiert mich aber nur der Essay Ein allgemeiner Glaube, der im Englischen unter dem Titel A Commen Faith separat erscheint, und auf deutsch nur hier in diesem Sammelband.
In diesem Essay entwirft Dewey eine Form des Religiösen jenseits von Dogma, Offenbarung und Kirche. Er unterscheidet zwischen dem „Religiösen“ als Haltung und „Religion“ als Institution – und plädiert für eine Glaubensform, die auf Erfahrung, Ethik und gemeinsamer Hoffnung beruht. Ein mutiger Versuch, Spiritualität neu zu denken: als weltverbundene Kraft, nicht als jenseitige Instanz. Keine Transzendenz von außen, sondern ein Ideal im Werden.
Beitrag zum Blog: Dewey unterscheidet Dewey zwischen „organized religion“ und „the religious“. Ersteres sind institutionalisierte dogmatische Systeme mit exklusivem Wahrheitsanspruch und fixierten Glaubensbekenntnissen. Letzteres ist ein Erleben, das sich durch Tiefe, Verbundenheit, Sinnsuche und moralisches Streben auszeichnet. Kernthese des Essays sinngemäß: Das Religiöse ist echt – die Religion nicht unbedingt.
Im Blog werde ich häufig auf diesen Unterschied hinweisen, den auch William James, Viktor Frankl, Daisaku Ikeda und Tsunesaburo Makiguchi erkannt haben. Dies ist mein Fundus, der mir hilft, „das Religiöse“ aus der Esoterik zu holen und in einen universalen Humanismus einzubinden.
Auch schlägt dieses Buch eine Brücke zwischen dem spirituellen Impuls des Buddhismus und dem demokratischen Selbstverständnis des Westens. Es erlaubt mir, über Glauben zu sprechen, ohne den Begriff zu opfern oder zu überladen.
[erschienen 2019 bei suhrkamp verlag wissenschaft, ISBN 3518298329]
Das steckt drin: Dies sind Deweys Vorlesungen, die er 1919/1920 während seines Aufenthalts in China hielt. Dewey war zwei Jahre lang in China unterwegs und war einer der wichtigsten westlichen Impulsgeber für die Bildungsreform und die Demokratisierungsdebatte in der damaligen Republik China. Erstaunlich ist hier sein Versuch, seine pragmatistische Philosophie auf neue kulturelle Kontexte anzuwenden, ohne sie dogmatisch zu exportieren. Er stellte Demokratie und Aufklärung als offene Prozesse dar, die sich an lokalen Bedürfnissen orientieren müssen. Dewey hat hier – in bemerkenswerter Nicht-Arroganz – eine interkulturelle Brücke geschlagen. Er spricht hier unter anderem von Demokratie als Lebensform und (Selbst-)Erziehungsprozess, von Bildung als Motor des sozialen Wandels und vom moralischen Fortschritt, der daraus resultiert.
Beitrag zum Blog: Hier stecken wertvolle Gedanken zum Verhältnis zwischen Demokratie und Bildung/Erziehung, aus denen sich einige Ressourcen zur Erneuerung und Ergänzung unserer heutigen Demokratie herstellen lassen. Die werde ich bergen und beschreiben.
Die geistige Verwandtschaft zwischen Deweys Denken und dem Soka-BuddhismusEine moderne Ausprägung des Nichiren-Buddhismus, benannt nach dem japanischen Mönch Nichiren (1222–1282). Wie andere buddhistische Traditionen teilt er Grundprinzipien wie die Vergänglichkeit aller Dinge, die wechselseitige Verbundenheit allen Lebens und das Ziel, Leid zu überwinden. Seine Besonderheit liegt jedoch in der More ist nicht zufällig: Tsunsaburo Makuguchi, der Gründer der Soka GakkaiZu deutsch etwa „Werteschaffende Gesellschaft“ – ist eine weltweite buddhistische Laienbewegung, die auf den Lehren des japanischen Mönchs Nichiren (1222–1282) basiert. Ihr Kern ist die Ausübung von Nam-Myoho-Renge-Kyo, dem Rezitieren des Titels des Lotos-Sutra, als unmittelbarer Weg, die in jedem Menschen vorhandene More, wurde in seiner reformpädagogischen Arbeit stark von Dewey inspiriert. Dewey wiederum hatte vor diesen Vorlesungen Japan besucht und dort Wellen geschlagen.
[erschienen 2023 bei Rowohlt Verlag, ISBN 3498003272]
Das steckt drin: Dieses Buch geht der Frage nach, was den Menschen eigentlich ausmacht und warum wir so widersprüchlich und labil handeln. Es begreift uns Menschen als Dauerbaustelle, als evolutionäres „work in progress“.
Weiterhin erklärt es die Dauer-Überforderung, in der wir dank unseres zivilisatorischen Fortschritts stecken. Unser Gehirn, unsere Wahrnehmung und unsere körperliche Konstitution können nicht Schritt halten mit dem Tempo der kulturell-technologischen Entwicklung, die durch uns hindurchrauscht.
Wir bekommen einen Abgleich, wie menschengerechtes Leben sein sollte und könnte – und wie es tatsächlich ist. Die Lücke erleben wir tagtäglich schmerzhaft: in unseren sozialen Verbänden, unseren Jobs, unserer Körperkultur, unserer Ernährung und so weiter.
Wir sehen die Anfänge einer neuen, evolutionär-neurobiologischen Menschenkunde, die weder biologistisch-deterministisch noch rein kulturell-ideologisch ist.
Beitrag zum Blog: Michel und van Schaik sind die einzigen Autoren in diesem Kanon, die hier und jetzt in der Gegenwart leben. Alle anderen Bücher haben ihren zeitlosen Wert bereits erhalten, weil sie längst aus den Bestseller-Listen und aktuellen Diskussionen verschwunden sind. Dieses Buch ist die Ausnahme, weil erst seit Kurzem die Erkenntnisse aus der Evolutions- und Neurobiologie bereitstehen, die für diesen Blog wichtig sind.
Wir haben hier, jenseits von bloßer Philosophie und Religion, eine neue wissenschaftliche Annäherung zu dem, was Mensch sein eigentlich ist.
In den letzten Jahren hat es eine gute Handvoll ähnlicher Bücher (Harari, Pinker, et. al.) in die Bestsellerlisten geschafft. Dieses überzeugte mich durch Stil und Haltung. Es tröstet entlastet und ermutigt. Deshalb dient mir dieses Sachbuch als Ressource, wenn ich philosophische Erkenntnisse und Forderungen mit den neueren Wissenschaften abgleiche.
Ich erkenne darin auch eine Antwort auf den Auftrag, den John Dewey, der in seiner „Erneuerung der Philosophie“ die Nähe zum Menschen „wie er ist“ und zu seinem Alltag gefordert hat. Heute, knapp hundert Jahre später, wissen wir besser, „wie er ist“.
Das Buch ist auch eine Einladung, unser „Mensch sein“ weiter in die Zukunft hinein zu erkunden: Was ist jetzt möglich? Wie können wir die schmerzhafte Lücke zwischen menschenunwürdigen Verhältnissen und menschenwürdigem Leben schließen? Genau dazu will mein Blog anregen – und dafür wird dieses Buch wertvolle Hinweise geben.
[erschienen 2013 bei oekom Verlag, ISBN 3962381363]
Das steckt drin: Ein Plädoyer für eine Wirtschaft, die sich nicht an Wachstum, sondern an Maß, Sinn und Menschlichkeit orientiert. Schumacher kritisierte bereits Anfang der 1970er die Zerstörungskraft moderner Technologien und entfaltet die Vision einer „Buddhist Economics“ – einer Ökonomie, die das Leben achtet, nicht verschleißt. Ein radikal anderes Denken über Arbeit, Technik und Fortschritt, das gerade heute – im Zeitalter der Überkomplexität und KI – wieder atemberaubend aktuell wirkt.
Beitrag zum Blog: Obwohl formal ein Wirtschaftsbuch, steht dieses Werk quer zu allem, was die Wirtschaftswissenschaft gewöhnlich treibt. Es passt in meinen Kanon, weil es die Ökonomie philosophisch, kulturell und spirituell überschreitet – nicht systemstützend, sondern systemhinterfragend. Für mein Blog liefert es eine seltene Perspektive: Wirtschaft nicht als Technik, sondern als Ausdruck von Haltung. Damit ermöglicht es einen Dialog zwischen innerer und äußerer Welt – und zeigt den Lesenden, dass es Alternativen gibt, die nicht utopisch sind, sondern überfällig.
[erschienen 2005 bei Derk Janßen Verlag, ISBN 3938871003]
Das steckt drin: Walt Whitman gilt mit seiner Gedichtsammlung „Grashalme“ als poetischer Gründervater einer eigenständigen US-amerikanischen Dichtung. Zugleich war er ein leidenschaftlicher und radikaler Demokrat, wovon „Demokratische Ausblicke“ Zeugnis ablegt. Nicht unbedingt ein schnell begreifbarer Essay, eher ein visionäres Dokument, das sich mit dem geistigen Nährboden der Demokratie befasst. Er formuliert einen poetisch-spirituellen Entwurf dessen, was Demokratie jenseits von Wahlen, Gesetzen und Marktinteressen sein könnte. Wer sich mit einigem Wohlwollen durch die überschwänglich-idealistisch anmutende Sprache mit seinen vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäßen Geschlechterrollen hindurchliest, entdeckt darin durchaus relevante Ideen zur Wiederbelebung unserer Demokratien. Vor allem erfrischt der visionäre Spirit dieses Werks, der zur selbstständigen Aktualisierung und Fortschreibung anregt.
Beitrag zum Blog: Whitman ruft zur inneren Arbeit am eigenen demokratischen Selbst auf. Genau dasselbe Anliegen vertritt der Soka-BuddhismusEine moderne Ausprägung des Nichiren-Buddhismus, benannt nach dem japanischen Mönch Nichiren (1222–1282). Wie andere buddhistische Traditionen teilt er Grundprinzipien wie die Vergänglichkeit aller Dinge, die wechselseitige Verbundenheit allen Lebens und das Ziel, Leid zu überwinden. Seine Besonderheit liegt jedoch in der More. Ich zitiere aus Whitmans Werk, wenn ich die geistig-spirituellen Grundlagen der demokratischen Lebensform verdeutlichen will und sie gegen die neo- und techno-faschistischen, autoritären und ultra-marktliberalen Tendenzen stelle, die an unseren Demokratien nagen. Kurz: Whitman bietet in diesem Werk (wie auch in seinen Gedichten) Seelenfutter für die verwundete Demokratie.
[erschienen 2020 bei PIPER Verlag, ISBN 3492316910]
Das steckt drin: Was tun wir eigentlich, wenn wir tätig sind? Dieser Frage geht Hannah Arendt nach. Dabei unterscheidet sie drei Grundformen des menschlichen Tuns: Arbeiten, das den Kreislauf des Lebens erhält; Herstellen, das dauerhafte Dinge schafft; und Handeln, das im Austausch zwischen Menschen Freiheit erfahrbar macht. Arendt zeigt, wie in der Antike der öffentliche Raum – die Polis – zur Bühne des Handelns wurde und wie dieser Raum in der Moderne durch Ökonomie, Verwaltung und Technik verdrängt wird. Ihre Diagnose: Wir haben das tätige Leben auf Funktion und Produktion reduziert und dadurch die politische und existentielle Tiefe unseres Daseins verloren. Vita activa ist kein nostalgischer Rückblick, sondern eine philosophische Einladung, Welt wieder als gemeinsames Werk zu begreifen.
Beitrag zum Blog: Arendts Denken hilft, die heutige Arbeits- und Wirtschaftswelt neu zu betrachten und erweitert die Möglichkeiten des Wert-Schaffens für uns alle, weit jenseits von „Effektivität“ und „Effizienz“. Vita activa öffnet den Blick auf eine zentrale Frage: Wie können wir unter modernen Bedingungen wieder handeln, statt bloß zu funktionieren? Wo wird Arbeit zu Weltgestaltung, wo zu Selbstverlust? Arendts Analyse der „Weltlosigkeit“ berührt genau das, was viele heute in Organisationen erleben: Beschleunigung ohne Richtung, Kommunikation ohne Gespräch. Im Zusammenspiel mit buddhistischem Denken zeigt sich: Das tätige Leben braucht nicht weniger Technik, sondern mehr Bewusstheit. Vita activa liefert damit einen philosophischen Schlüssel, um Wirtschaft als menschliches, nicht nur ökonomisches Handeln zu begreifen, durch das Freiheit, Sinn und Mitmenschlichkeit wieder möglich werden.
[erscheint seit 2020 im Derk Janßen Verlag, bisher ISBN 3938871-17-1/19-5/21-8/24-9/25-6]
Das steckt drin: Die Zeitschrift Sukzession versammelt halbjährlich Essays über Natur, Demokratie und Kunst. Ihre geistige Linie führt von Goethe, Emerson und Thoreau bis zu Beuys – also genau jenen Stimmen, die auch diesen Kanon prägen. Sie ist unzeitgemäß im besten Sinn: tief, langsam, widerständig gegen den Mainstream. Keine Reaktion auf Tagesrauschen, sondern Resonanzraum für bleibende Fragen.
Beitrag zum Blog: Derk Janßen ist ein enger Wegbegleiter meines eigenen Projekts. Er begleitet meinen Blog kritisch, und ich verdanke seiner Arbeit viele Anstöße. Diese Nähe will ich nicht verbergen – im Gegenteil: Sie macht sichtbar, dass intellektuelle Arbeit nicht im luftleeren Raum entsteht, sondern in Resonanz mit anderen.
Diese 16 Bücher sind kein gemütlicher Lesesessel, sondern ein Spannungsfeld. Buddhistische Quellentexte und Kommentare liefern die ethische und spirituelle Grundlage. Philosophie, Pädagogik, Psychologie, Anthropologie und Literatur bringen Gegenstimmen, Prüfsteine und frische Blickwinkel ein. Jedes Werk steht für eine eigene Tonlage – erst im Zusammenspiel entsteht der volle Klang. So wird aus dem Kanon ein Resonanzraum, in dem sich zeitlose Einsichten und heutige Herausforderungen gegenseitig schärfen.
Der Blog richtet sich klar auf Themen und Probleme der Wirtschaft und Arbeitswelt – und doch fehlt hier bewusst jedes Wirtschaftsbuch, ob Bestseller oder Klassiker à la Adam Smith. Das ist kein Versehen, sondern Absicht. Ich will Terrain neu betreten. Wer die Wirtschaft verändern will, darf nicht im Vokabular ihrer alten Selbstbeschreibungen gefangen bleiben. Stattdessen ziehe ich die großen Linien aus anderen Disziplinen – aus Lehren, die den Menschen ins Zentrum stellen, nicht Märkte oder Modelle. Deshalb mach ich nur eine Ausnahme: mit dem Anti-Wirtschafts-Wirtschaftsbuch von E. F. Schumacher Small is Beautiful – weil es diese Programmatik bereits aufgreift.
Der Kanon ist mein geistiger Prüfstand: Er zwingt zu Disziplin, schützt vor gedankenlosem Trendhopping und bremst das Abgleiten in die Solo-Welterklärer-Nummer. Er liefert den langfristigen Unterbau, auf dem sich aktuelle Beobachtungen verankern lassen – ohne in die Kurzfristlogik von Moden, Buzzwords und Beratungsfloskeln zu verfallen. Wer hier liest, soll spüren: Hinter jedem Beitrag steht ein Netz aus Stimmen, die sich bewährt haben – und die gemeinsam eine Perspektive eröffnen. Eine, in der Wirtschaft und Arbeit wieder dem dienen, worum es im Kern geht: es geht um uns, die Menschen, die gut leben und arbeiten wollen.